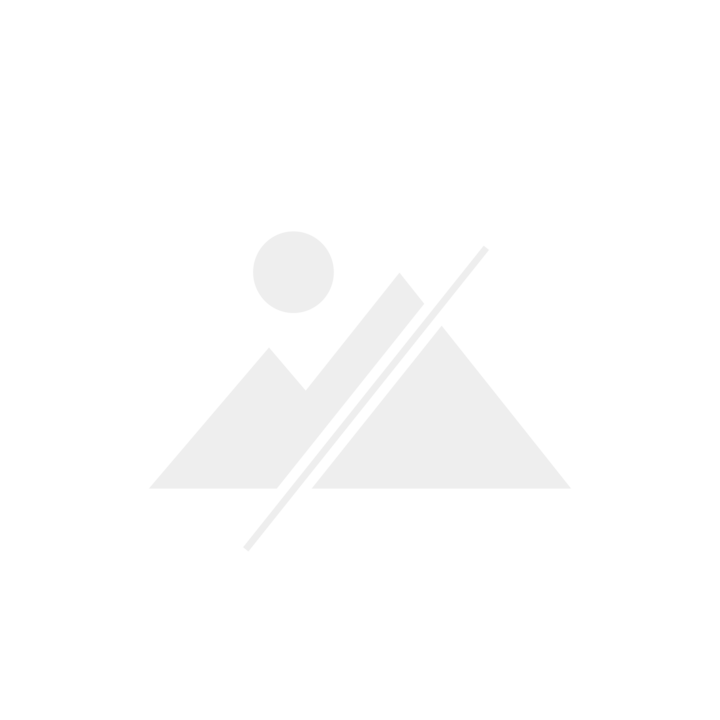

Wie ich 30 Jahre später endlich Zelda in «A Link to the Past» rette
Dieser Beitrag hat mich Schweiß und Tränen gekostet. Warum? Weil es um «The Legend of Zelda: A Link to the Past» geht. Und weil ich dieses Spiel hasse, beziehungsweise … hasste. Womit wir beim Kern der Story wären.
Ich kenne kein anderes Game, das mich als Teenagerin dermaßen zur Verzweiflung gebracht hat wie die schier endlose Suche nach dieser dummen Zelda. Getarnt als virtueller Link irrte die 12-jährige Anika durch Hyrule und fand einfach alles nur schlimm. Landkarte zu unübersichtlich (Help, wo muss ich hin? Und was ist dieses Kakariko?), Steuerung zu fummelig und ungenau, Dungeons zu schwer und überhaupt überforderten mich die Rätsel damals maßlos. Vielleicht lag es daran, dass ich bis dato nur Jump 'n' Runs gewöhnt war. Jedenfalls: Ich bzw. Link war öfter tot als lebendig. Der Spieleberater von Nintendo war zwar hilfreich, blieb aber an den entscheidenden Stellen doch recht kryptisch. Internet kannte ich noch nicht, googeln fiel also aus.
Ich erinnere mich noch heute daran, dass meinem Teenie-Ich irgendwann bloß beim Hören der Titelmusik von «Zelda» der Puls hoch ging. So sehr stresste mich dieses Game. Bis zum sechsten Dungeon in der Schattenwelt, dem Eispalast, habe ich mich gequält und dann aufgegeben.

Quelle: Nele Ohlsen
Das war und ist bitter, vor 30 Jahren wie heute. Denn wenn ich eine Sache richtig gut kann, dann ist es, für verzwickte Gaming-Probleme eine Lösung zu finden. Ich habe bei «Super Mario Kart» Streckenrekorde auf der Rainbow-Road aufgestellt und mich durch alle Loren-Level von «Donkey Kong Country» gezockt. Obwohl man dafür wahrlich mehr Glück als Verstand braucht.
Doch «Zelda» … Nein, danke. Das Spiel hatte ich seit dem Eispalast-Eklat Mitte der 1990er nicht mehr angerührt. Bis ich mich in einer Mittagspause mal mit meiner Kollegin Debbie über «Zelda» austauschte. «Das ist doch so ein beeindruckendes Spiel! Ich habe so schöne Erinnerungen daran. Wie kannst du das nicht mögen?», schaute sie mich fragend an – und in mir begann es zu rattern. Hat Debbie Recht? Habe ich was verpasst? Das will ich herausfinden. Und so begibt es sich, dass ich mich mit 42 Jahren an meine Nintendo Switch setze und «A Link to the Past» eine letzte Chance gebe. Den Verlauf der Ereignisse liest du hier.
Der Start und die Lichtwelt
Puh, nun geht’s also los. Switch an und «The Legend of Zelda: A Link to the Past» starten. Und da ist sie wieder: diese bedrohliche Titelmusik. Instinktiv stellen sich meine Nackenhärchen auf, kein Witz. Schnell einen Schluck Kaffee trinken und durchatmen. Ich bin also wieder Link. Ein kleiner pixeliger Zeitgenosse, ausgerüstet mit einem Mini-Schild und einem ebenso kleinen Schwert. Ich werfe einen Blick auf die Landkarte und gehe los in Richtung Schloss Hyrule, um Zelda zu suchen.
Dort angekommen fällt es mir wieder ein: Ich muss frontal vor den Gegnern stehen, um sie vernünftig zu treffen. Und das ist mit der gurkigen Steuerung des virtuellen SNES ein Krampf. Denn entweder stehe ich mitten auf dem Gegner (Bin also tot.), zu dicht am Gegner (Bin also auch tot.) oder ich drehe ihm den Rücken zu und werde angegriffen (Ebenfalls tot.). Ich brauche ein paar Anläufe, um mich an die Steuerung zu gewöhnen, doch dann geht es erstaunlich gut. Ich befreie Zelda und bringe sie zum Priester, der mir den Auftrag gibt, drei Amulette aus den Dungeons der Lichtwelt zu besorgen.

Quelle: Nintendo
Nach einem kurzen Abstecher ins Dorf Kakariko mache ich mich auf zum Ostpalast. Dort bekomme ich endlich weiteres Equipment – Pfeil und Bogen – und bevor ich mich versehe, stehe ich auch schon vor dem Endboss. Beziehungsweise den sechs Endbossen, den Armosrittern. Das sind sechs Typen in Rüstung, die lustig im Kreis hüpfen und mich platt machen wollen. Ich erinnere mich daran, dass ich früher damit meine Mühe hatte. Mich verwirrte die Perspektive, von oben auf das Geschehen zu gucken. Und ich tat mich sehr schwer, Link so zu steuern, dass ich nicht von den Rittern niedergestampft wurde. Dieses Mal klappt es direkt im ersten Anlauf. Ich ziele mit Pfeil und Bogen, schieße ein paar Mal daneben, treffe öfter – und fertig. Erstes Amulett ergattert.
Mit den zwei weiteren Dungeons der Lichtwelt läuft es ähnlich gut. Ich marschiere durch den Wüstenpalast und Heras Turm, als hätte ich nie etwas anderes getan. Ab und zu huscht mir sogar ein Lächeln übers Gesicht. Und so langsam frage ich mich: «Anika, was ist passiert, dass dieses Spiel plötzlich so einfach ist und dir Spaß macht?» Vielleicht liegt es daran, dass mich meine pubertären Stresshormone verlassen haben und ich entspannter bin als früher. Was auch sein kann: Ich habe vor etwa 10 Jahren sehr intensiv «World of Warcraft» gespielt – und das ist natürlich wesentlich komplexer. Vergleiche ich nur schon die Weltkarte von «WoW» mit der vom 1991er «Zelda», ist das ein gigantischer Unterschied. Gegen Azeroth ist Hyrule ein Dorf. Insofern dürfte sich meine Frustrationsgrenze bei Videospielen deutlich nach oben verschoben haben.

Quelle: Nintendo
So oder so: In der Lichtwelt fehlen mir nur noch das Masterschwert, das ich ganz König-Artus-like aus einem Stein ziehe, und der Endboss. Agahnim hat sich im Burgturm von Schloss Hyrule verschanzt. Natürlich rettet der Zauberer sich in letzter Sekunde und entführt Zelda in die Schattenwelt, aber das wusste ich ja vorher.

Quelle: Nintendo
Hilfe und Tricks
Bevor es mit der Schattenwelt weiter geht, lege ich ein paar Beichten ab. Du hast dich sicherlich gefragt, ob ich mir das Aufarbeiten meines kleinen «Zelda»-Traumas mit irgendwelchen Tricks einfacher mache.
Anika, spulst du zurück?
Oh, YES! Das tue ich, und ich würde es immer wieder tun. Ich bin sehr dankbar für die Errungenschaften der modernen Technik und der Tatsache, dass ich bei Nintendo Online zurückspulen und misslungene Gaming-Momente retten kann. Das spart Zeit und Nerven. Und wie du weißt, lagen die Nerven bei mir früher blank und ich muss mir das Leben ja nicht unnötig schwer machen.
Benutzt du Online-Hilfen?
Auch definitiv ja! Ein lieber Mensch hat mir den originalen Spieleberater eingescannt und gemailt, sodass ich ihn immer auf dem iPad bereit habe. Außerdem habe ich die Webseite zeldachronicles.de entdeckt, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen für alle Dungeons und das Finden von Equipment bereithält. In der Lichtwelt habe ich die Webseite nicht oft gebraucht, aber ich bin mir sicher, dass ich sie in der Schattenwelt lieben werde.
Schämst du dich deswegen nicht?
Kein Stück.

Quelle: Anika Schulz
Wie beruhigst du deine Nerven?
Mit Kaffee, Franzbrötchen, Bier und Pizza. Und ich beruhige mich mit der Anwesenheit meiner Kusine, die ein ebenso großer Nintendo-Fan ist wie ich. Und im Gegensatz zu mir hat sie als Kind «The Legend of Zelda: A Link to the Past» durchgespielt – ohne YouTube, nur mit dem Spieleberater. Sie weiß also, was zu tun ist. Hoffe ich zumindest.
Die Schattenwelt und der Eispalast
Da stehe ich also nun auf der Pyramide in der Schattenwelt. Und plötzlich dämmert es mir: Ab hier wird das Game so richtig kompliziert. Dunkle Erinnerungen an frustrierte Abende in meinem Kinderzimmer – inklusive dramatischem Controller-an-die-Wand-Pfeffern – kommen hoch. Schluck. Dieses Mal will ich es besser machen und schlage prophylaktisch den Spieleberater auf. Aha, ich soll mir zunächst das Amulett der Erde und das Amulett der Luft besorgen. Okay, wird erledigt. Bei meinem ersten Ausflug durch die neuen Lande wird mir schnell klar, dass der Spaziergang vorbei ist. Die Gegner sind noch aggressiver als im Burgturm. Ein Treffer und mir gehen gleich zwei Herzchen Lebensenergie flöten. Na, das kann ja was werden.
Dennoch mache ich mich auf den Weg zum ersten Palast in der Schattenwelt, der ironischerweise Schattenpalast heißt. Hahaha, sehr witzig, Nintendo. Nach einer ersten Stippvisite ist klar: Das wird hier so nichts. Der Palast ist groß, unübersichtlich und ich beginne mich zu fragen, ob das alles eine sooo clevere Idee war. Wem will ich eigentlich was beweisen? Ach ja, mir selbst. Super, Anika. Ganz super. Glücklicherweise ist heute wieder meine Kusine zu Besuch, die mir zur Beruhigung erst mal ein frisches Franzbrötchen unter die Nase hält. Mampf. Das hilft. Und sie übernimmt ab hier die Rolle der Co-Pilotin. Heißt: Sie navigiert mich durch den Schattenpalast, sodass ich mich nur auf die Gegner konzentrieren muss und nicht auch noch gleichzeitig auf die Karte, auf YouTube, auf den Spieleberater und auf die Online-Hilfe schiele. Und siehe da: Es läuft.

Quelle: Nintendo
Innerhalb von anderthalb Tagen zocken wir uns gut gelaunt im Tandem durch Zweidrittel der Schattenwelt. Wir sammeln Rubine, Kristalle und Erfahrung. Klar läuft auch mal hier und da was schief. Beispielsweise irren wir ewig bei den Wasserfällen herum, bis wir den fischigen Zora-König gefunden haben, um die Schwimmflossen abzuholen. Und wir besorgen auch nicht alle Herzteile in der Schattenwelt. Einfach aus dem Grund, weil wir a) keinen Bock haben, beispielsweise den Schatzgarten beim Dorf der Diebe 17-mal umzugraben, oder weil wir b) ja schließlich zurückspulen können, wenn Link stirbt. Hihi.
Mein persönlicher Endgegner
Dieses Vorgehen spart enorm Zeit und plötzlich stehe ich vor meinem persönlichen Endgegner, dem Eispalast. Meine Stimmung kippt von sonnig zu frostig. Hier hatte ich schließlich als Teenagerin aufgegeben. Schon, als ich die zittrig-kühle Hintergrundmusik in dem Dungeon höre, läuft es mir buchstäblich eiskalt den Rücken runter. Doch auch hier rettet mich zunächst meine Co-Pilotin mit ihrer pädagogischen Art. «Anika, guck mal, der Palast ist gar nicht so groß. Der hat nur viele Stockwerke. Und der Boss ist auch nicht so schwer», beruhigt sie mich. «Willst du vorsichtshalber noch ein Franzbrötchen für die Nerven?» Ja, will ich! Ich muss an dieser Stelle wohl nicht extra betonen, dass der Eispalast auch 30 Jahre später nicht mein Freund ist. Und selbst meine gerade noch so coole und versierte Kusine hat Mühe, sich zurechtzufinden und den Spieleberater richtig zu lesen. «Die Karte hier ist so klein gedruckt. Ich erkenne das nicht gut. Kannst du noch mal zurückgehen? Da muss irgendwo ein Schalter sein», fragt sie mich nach einer Stunde erfolglosem Orientierungslauf in der frostigen Hölle. Nein, ich kann und will nicht wieder zurückgehen. ICH. WILL. HIER. RAUS.
Irgendwann bin ich dann bei Kaltstarre, dem Endboss, angekommen. Nachdem ich ihn erlegt habe, ist das Spiel für mich gefühlt vorbei. Der Angstgegner ist besiegt. Mir zischt der Gedanke durch den Kopf, dass ich jetzt einfach aufhören könnte. «Ich bin weiter gekommen als je zuvor. Warum soll ich mir jetzt noch den Stress geben?», wabert es in meinem Hirn. Meine Kusine und ich bestellen erst mal eine Pizza. Danach vertagen wir die Fortsetzung von «A Link to the Past» auf unbestimmt.

Quelle: Nintendo
Die letzten Dungeons und der Endboss
Zugegeben: Nach dem Eispalast fällt es mir schwer, mich zu motivieren, den Rest des Games zu spielen. Klar, es macht in Summe mehr Spaß, als ich erwartet hatte. Aber die Herausforderung ist weg. Dass meine Kusine wenig Zeit hat, macht es nicht besser. Und so brauchen wir tatsächlich ganze zwei Monate, bis wir uns zur finalen Zelda-Rettungsaktion treffen. Zwei Dungeons und der Endboss in der Schattenwelt sind noch übrig.
Die letzten beiden Paläste der Schattenwelt, der Wüstenseepalast und der Schildkrötenfelsen, sind nicht der Rede wert. Meine Kusine und ich sind ein eingespieltes Team. Sie navigiert, ich prügle mich durch die Dungeons. Es sei denn, irgendwo müssen Fackeln innerhalb kurzer Zeit in einer bestimmten Reihenfolge angezündet werden, damit sich Türen öffnen. Dann übergebe ich den Controller an die Verwandtschaft. Ich bin dafür einfach zu ungeduldig, währenddessen meine Kusine es jedes Mal lässig hinkriegt. Arbeitsteilung par excellence.
Bleibt also nur noch der finale Bossfight, beziehungsweise der Weg dorthin. Als Warm-up gucke ich mir YouTube-Videos an, wie ich Ganon bezwingen kann. Der Kampf wirkt uninspiriert. Erst muss ich Ganon mit dem Schwert auf die Mütze hauen und ihn anschließend ein paar Mal mit meinen Silberpfeilen abschießen. Aha, also nichts Neues. Mehr oder weniger motiviert mache ich mich an den letzten Teil meiner persönlichen «Zelda»-Saga …
Und auch bei meiner Co-Pilotin scheint langsam die Luft raus zu sein. Obwohl Ganons Turm das reinste Labyrinth ist, seufzt sie: «Hier musst du erst mal allein weiter. Ich blicke selbst nicht durch, sorry», und verzieht sich in die Küche, um uns Kaffee zu kochen. Kein Problem. Ich habe inzwischen genug Erfahrung, um mir selbst zu helfen. Irgendwann kommt meine Kusine mit zwei dampfenden Tassen Koffein wieder und begleitet mich durch die letzten Räume, bevor ich Ganon gegenüberstehe. Der ja eigentlich nur noch ein Klacks sein dürfte. Eigentlich.
Denn: ÜBERRASCHUNG! YouTube lügt. Ich weiß nicht, wie es der Mensch in diesem Video angestellt hat, Ganon in unter drei Minuten zu killen. Ich weiß nur, dass er entweder sehr viel geübt hat oder dass Videoschnitt sein bester Freund ist. Denn Ganon ist saunervig! Nicht nur, dass der Typ sich dauernd hin und her teleportiert. Nein, ich muss auch ständig mein Equipment wechseln, um ihm Schaden zuzufügen. Das heißt, ich bin mehr damit beschäftigt, die X-Taste auf dem Controller zu drücken, als den Boss zu verkloppen. Zu allem Überfluss passiert auch noch das, was ich am wenigsten kann: Das Licht geht aus und ich muss Fackeln anzünden, damit ich Ganon überhaupt sehen kann. Dummerweise kann ich schlecht mitten im Bossfight den Controller an meine Kusine übergeben, sodass ich notgedrungen selbst agiere. Und das offenbar mehr schlecht als recht, denn von nebenan auf dem Sofa kommt ein vorsichtiges: «Soll ich mal versuchen?» Das ist lieb gemeint, aber: Kurz bevor mein letztes virtuelles Lebensherz erlischt, treffe ich Ganon mit einem finalen Silberpfeil.

Quelle: Nintendo
Regungslos starre ich zuerst meinen Fernseher an, dann meine Kusine. Die starrt mit großen Augen zurück. Wir haben es geschafft! Ganon ist besiegt, Zelda gerettet und Hyrule befreit. Ich bin auch befreit – und zwar von meinem «Zelda»-Trauma. Und mein geliebtes Kusinchen? Das hat mehr als eine XXL-Pizza gut bei mir.
Und nun?
Nun bin ich kuriert. Ich habe «A Link to the Past» seitdem nicht wieder angerührt und werde es auch nicht tun. Das Spiel ist für mich beendet. Es gibt nichts mehr zu holen.
Was neu ist: Ich bin «Zelda»-Fan! Ich mag die Art und Weise, wie das Spiel Strategie, Geschick und Ausdauer belohnt. Und dass ich nicht «nur» durchrennen und hüpfen muss wie bei «Super Mario Bros.». Deswegen probiere ich wohl auch das neue Game «The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom» aus. Aber dazu in einem anderen Beitrag mehr.
The End.
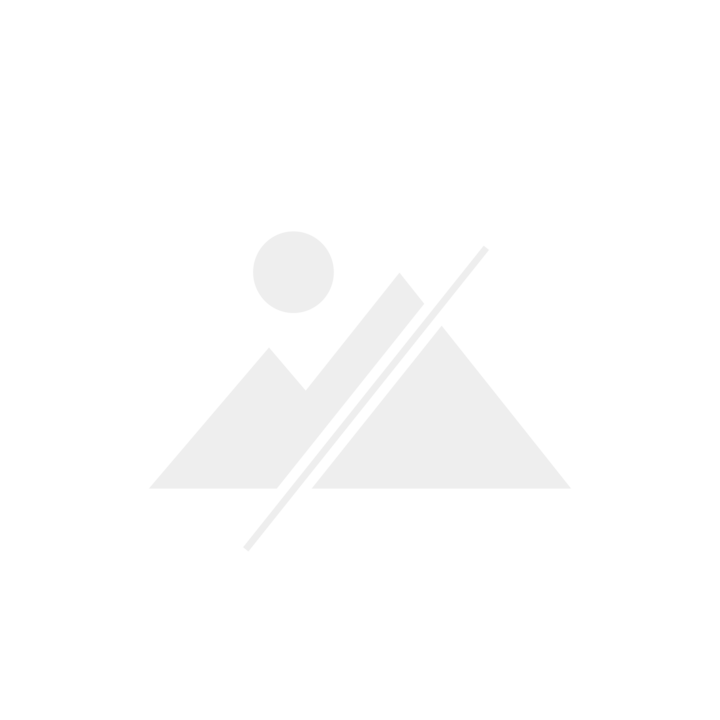
Als Kind wurde ich mit Mario Kart auf dem SNES sozialisiert, bevor es mich nach dem Abitur in den Journalismus verschlug. Als Teamleiterin bei Galaxus bin ich für News verantwortlich. Trekkie und Ingenieurin.


